Die Zusammenfassung eines Festivaltages auf dem Rototom
Wie jedes Jahr verwöhnte mich das Rototom mit gemischten Gefühlen. Sei es, weil man mir meine Kamera und damit Aufnahmen einer der schönsten Bergregionen Spaniens entwendet hat; sei es weil ich bis in die Morgenstunden feierte und reflektiv nicht mehr ganz so fix unterwegs war, was Spaniens Trinkwasservorräte angeht; oder weil ich das ganze Festival über schon wieder eine Erkältung ausgebrütet hab, die sich ob meiner Willenskraft allerdings noch bis einen halben Tag nach Festivalende (sprich bis Alfred fertig zur Abreise beladen war) Zeit lies, ehe sie sich in meinem Hals manifestierte.
Ich liebe dieses Festival. Und ich verabscheue es zugleich. – Aber ich komme wieder. Immer wieder. Und vielleicht schaffe ich es nächstes Mal sogar ein bisschen mehr von all dem mitzunehmen, was einem ein Festival dieser Größenordnung noch so zu bieten hat. Es gibt so vieles. Dieses Jahr lag mein Fokus jedoch ganz klar auf dem Feiern. – Ich hatte allen Grund dazu und hab ihn in jeder Minute ausgekostet!
Für euch fasse ich ihn nun zusammen, den typischen Festivaltag, wie ich ihn dieses Jahr unaufhörlich mit etwa der gleichen Ausdauer zelebriert hab, wie ich sie auch auf meinem Weg dorthin schon an den Tag legte. (Kein Wunder, dass sich mein Körper danach zwanghaft nach einer Ruhepause sehnt.)
Es ist etwa 10 Uhr morgens (wenn man Glück hat, war es nicht gerade jener Tag, an dem ich um 10 Uhr morgens noch frische Brötchen beim Bäcker holen war.) und die Sonne scheint zwischen all den zerfetzen Planen genau in jenem Winkel auf den Zeltplatz, dass man sich unter keinerlei Umständen noch eine weitere Minute zwischen der luftleerern Isomatte, den restlichen verstreuten Einzelheiten seines Gepäcks und einer verlorenen Nähnadel räkeln will. – Man muss die Hand ausstrecken um das Zelt zu öffnen. Am besten gleich auf beiden Seiten. Zu der einen Seite hin begrüßt man kurzerhand halblebig die beiden weiblichen Jochens, die sich am Vortag mit ihrem Zelt an meins gekuschelt hatten. Zu der anderen Seite hinaus streckt man seine Beine, die für die nächste Stunde für einen gewissen Selbstbetrug sorgen sollen, was die Kerntemperatur des Zeltes anbelangt. (Liegen die Beine in der Sonne, fühlt sich der Rest vom Körper vergleichsweise erfrischt an.)
Irgendwann verflucht man Fahrenheit und Celsius zugleich, wünscht sich bei der Gelegenheit in der Geschichte der Wissenschaft wäre alles irgendwann mal beim alten geblieben und was heute bei 100° siedet, würde in Wahrheit gefrieren. Es bleibt einem also keine Wahl und man verzieht sich auf die Wiese (von der nur Gott selbst weiß, wie sie dorthin kommt) unter die Hängematte vom Selfie-Jochen, die als Schattenspender herhalten muss und schlägt ihn in seiner Traumjagd nach diversen nervenden Fliegen fortwährend aus dem Schlaf.
Es ist nun bereits knapp 1 Uhr und wenn man mal Fünfe grade sein lässt, kann man von den Vier auch noch gleich 3 Stunden abziehen, was einen zu seinem nächsten Handlungsstrang in Richtung einer leichten Erfrischung treibt: „Hey Jochen! Gib mal n kühles Bier bitte! Es ist jetzt Eins und ich hat‘ noch keins.“ (Oder so ähnlich. – Reim unterliegt der künstlerischen Freiheit des Autors.)
Nachdem man sich dieses nun unter langsamem Seufzen verinnerlicht hat, etabliert sich so langsam der Gedanke für die morgendliche Toilette. Wenn man schlau ist, kombiniert man alles nötige dafür in einem einzigen Aufwasch (ich hab mir dafür extra alle nötigen Utensilien in einem roten Beutel zusammengelegt, den man auch mit schmalen Augen im Zeltwuscht ausfindig machen kann), spricht unterwegs je nach Laune auch mal ein paar Gleichgesinnte an, wird mitunter überraschend von anderen Gleichgesinnten über das erfolgreiche Bier-Pong-Turnier der vergangenen Nacht aufgeklärt und begibt sich nun auf die morgendliche Odyssee zwischen Toilette, Zahnputzbecken und FKD (Freikörperdusche).
Ist das alles erledigt kann man zurück am Campingplatz erfolgsverkündend das zweite Bier zu sich nehmen und sich mal den Weg zum Strand auf der Zunge zergehen lassen. Nach einem kurzen Feedback der restlichen Zeltgemeinschaft, wo es denn heute hin gehen solle, fängt man (in meinem Fall) in Gedanken an seine Fahrradtaschen zu packen (die im Idealfall jedoch vom letzten Tag noch gepackt sind) und radelt gemächlich mit einem kurzen Zwischenstopp beim Lost-And-Found-Büro vorbei, wo man seine einstudierte Tragödie ein weiteres Mal zum besten gibt.
Der Witz an der ganzen Geschichte ist, dass man mit dem Fahrrad im Schnitt immer eine halbe Stunde vor allen anderen am Strand ankommt. Zwar macht das keinen rechten Sinn, nachdem man sich im Anschluß an die Abfahrt dazu entschlossen hat, den zweiten Teil seiner Dreckwäsche nun doch noch zu waschen und sich am Festivalausgang zudem noch mit einem Italiener über die verschiedensten Fertigkeiten der Schmuckherstellung ausgetauscht hat. – Aber hey! Ich beschwer mich als letzter, wenn ich mal zuerst da bin.

Am Strand angekommen hält man natürlich trotzdem nach seinen Zeltnachbarn Ausschau, lässt das bunte Treiben der Festivalgesellschaft auf sich wirken, streckt seine Hand nach dem dritten Bier des Tages aus und ergibt sich irgendwann der Erkenntnis, dass man die anderen wohl nie finden wird. Meist trudeln sie jedoch just in diesem Moment aus Richtung Bushaltestelle ein.
Noch etwas mitgenommen von der Nacht sucht man sich langsamen Schrittes ein schattiges Plätzchen im staubigen Sand und döst erst mal eine gute Runde. Da sich diese Gelegenheit so schnell nicht mehr ergeben wird, nutzt man die Gunst der paar Stunden und hängt noch zwei weitere Runden dran.
Gegen 6 Uhr abends dreht man erholt sein leicht zerknautschtes Gesicht aus dem Staub, berät sich über die abendlichen Einkäufe und schüttelt erst mal den ganzen feinen Sand aus seinem Handtuch, der sich inzwischen, ähnlich wie elektrisch aufgeladene Styroporkügelchen, darauf ausgebreitet hat. Sehr zum Ärgernis seiner Strandnachbarn, die gerade dabei sind, sich ein Avocado-Sandwich zuzubereiten, achtet man dabei natürlich nicht auf die Windrichtung.
Es herrscht Aufbruchstimmung. Damit sich diese vom Geist auch auf die Muskeln überträgt, benötigt man logischerweise etwas Koffein. Am besten in Form eines guten Drinks. Um dieser Idee zu etwas mehr Materialität zu verhelfen, verzieht man sich in die Strandbar von gegenüber, deren hervorragende Carajillos man schon ein paar Tage zuvor ausgekundschaftet hatte.
Ein Carajillo ist im Prinzip das spanische Äquivalent eines Vodka-Bull’s – Alkohol mit Koffein, nur eben mit mehr Stil. Ich erklär euch mal kurz den Unterschied: Wenn ich mich wirklich mal in Ermangelung von Alternativen darauf herablasse, einen Vodka-Bull zu trinken und dabei meine Augen schließe, manifestiert sich vor meinem inneren Auge (wahlweise auch der Nase) das Sinnbild eines klebrigen Disko-Fußbodens, den man nach erfolgtem Zapfenstreich noch für ein paar gute Stunden stehen lässt, ohne mit dem Wischmob drüber zu gehen. Einfach nur, damit er sein volles Aroma entfalten kann. – Ein Carajillo dagegen ist der perfekte Abschluss eines spanischen Abendessens. Schließt man bei seinem Genuss die Augen, schwenkt ein fescher Torero die spanische Flagge und eine rassige Senorita gibt in einem wallenden, roten Kleid ihren Flamenco zum besten. Ja, ich denke das trifft es ganz gut. – Da ich was für spanische Ladys übrig hab, gesellt sich zum ersten Carajillo meist gerne noch ein zweiter hinzu und nun werde ich selbst zum Flamencotänzer. Es kann losgehen! Der Abend hat mich wieder.
Motiviert und putzmunter wie ein Känguru, erledigt man auf dem Heimweg die abendlichen Einkäufe, verstaut diese jedes mal auf wahnsinnig abenteuerliche Weise in den verschiedenen Gepäcktaschen seines Fahrrads und im Anschluss daran (auf dem Campingplatz) den größten Teil natürlich in der Eisbox. Der Vorabend, das heißt bevor man auf das Festivalgelände geht, ist eigentlich der beste Teil vom Tag. Man trifft sich nochmals gemeinschaftlich am Zeltplatz, nimmt den einen oder anderen gemeinsamen Drink, berät sich über das Abendprogramm, lacht, tanzt Flamenco und so weiter und so fort…

Irgendwann begibt sich der eine Teil der Campingplatzgemeinde in die so genannte „Cocina“, das Küchenzelt, um für die nötige Basis zu sorgen. Ein guter Teil davon kommt in regelmäßigen Abständen immer mal wieder zum Zeltplatz zurück, sei es weil es an ein paar Zutaten fehlt, das Bier ausgegangen ist oder einfach nur um ein bisschen frische Luft zu schnappen. Ich pflege zu dieser Uhrzeit meist die nächtliche Dusche aufzusuchen, um den Dreck des Tages loszuwerden bzw. Platz für den Dreck der Nacht zu machen.
Bis man auf dem Festivalgelände eintrifft, hat man in der Regel das erste Konzert schon verpasst. Aus diesem Grund macht es auch meistens wenig Sinn, sich über die ersten Konzerte auszutauschen, sie einander beim abendlichen Flamencotanz zu empfehlen oder gar zu versuchen sie anzuschauen. Wer sich wirklich die Mühe gibt und sich ein Konzert um 20 Uhr 45 anschaut, tut dies meistens allein. Es ist praktisch unmöglich auch nur einen Mitstreiter zu finden. Als wäre das nicht genug, rutscht man offenbar in eine andere Zeitzone des Festivals hinein, aus der man die komplette Nacht über nicht mehr herausfindet. Sprich, man bleibt allein. Die ganze Nacht. Von seiner Truppe trifft man zwar niemand mehr, dafür aber ganz viele andere nette Leute.
Doch nehmen wir einfach mal an, dass man gemeinschaftlich (wie es sich gehört) das erste Konzert (und vielleicht noch einen guten Teil des zweiten) verpasst und sich an der üblichen Stelle auf dem Konzertgelände einfindet. (In diesem Zusammenhang ist der Begriff „übliche Stelle“ allerdings mit Vorsicht zu genießen. Von Tag zu Tag variiert sie zwar kaum, ob sie allerdings auch die Jahre überdauert, ist eher zweifelhaft. – Welche Umstände genau einen jedes Jahr zu der „üblichen Stelle“ führen, ist ebenfalls schwer zu sagen. Ich mutmaße hier jetzt einfach mal, dass es ein Zusammenspiel aus Publikumsmenge, dem Weg zur nächsten Bar, guter Sicht und der Vermutung ist, an der „üblichen Stelle“ auf ein paar hübsche Mädels zu treffen. Lustigerweise ändert sich kaum etwas an der üblichen Stelle, selbst wenn man dort keine erfreulichen Bekanntschaften schließt. – Ist wohl so ähnlich wie beim Lotto-Spielen, wenn man immer wieder auf die selben Zahlen tippt.) So. Da ist man also. Man trinkt, tanzt (um der netten Bekanntschaften willen hoffentlich keinen Flamenco), trinkt nochmal, tanzt und trinkt gleichzeitig (was in den wenigsten Fällen gut geht) und entscheidet sich irgendwann dazu, allein oder in der Gruppe, mehrere Pizzen essen zu gehen (wer jemals auf dem Rototom war, weiß wovon ich spreche). Was nun passiert ist eigentlich eine Laune des Universums (vorausgesetzt es gerät nicht gerade aus den Fugen, weil jemand brauchbaren Dancehall auf der Bühne spielt). Entweder man geht zurück zur Hauptbühne, wo die Konzerte bis etwa 3 Uhr morgens weiter gehen oder schaut sich mal den Rest vom Fest an. – Und dieser ist wirklich riesig. Immens riesig. Man tingelt vom Roots-Zelt zur Dubstation, vom African Village zur Mega-Jukebox oder in eines der Zelte nebenan. Lustigerweise bin ich auf der zweiten Bühne immer erst bei Sonnenaufgang gelandet. (… Ich lass den Satz jetzt einfach mal so stehen. Denn auch wenn er die Tatsachen eigentlich verdreht, scheint er trotzdem sehr gehaltvoll zu sein.) Man verliert sich oder man verliert sich nicht. Man findet sich wieder oder begegnet anderen. Manchmal legt man sich auch einfach nur ’ne Runde aufs Ohr und ist dann völlig überrascht die halbe Nacht verpennt zu haben. All das passiert auf dem Rototom. Und gleichzeitig passiert es auch nicht. Manchmal geht man morgens um 10 Uhr aber auch einfach nur frische Brötchen holen.

Foto: Steli
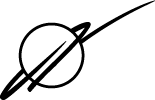

Leave a reply